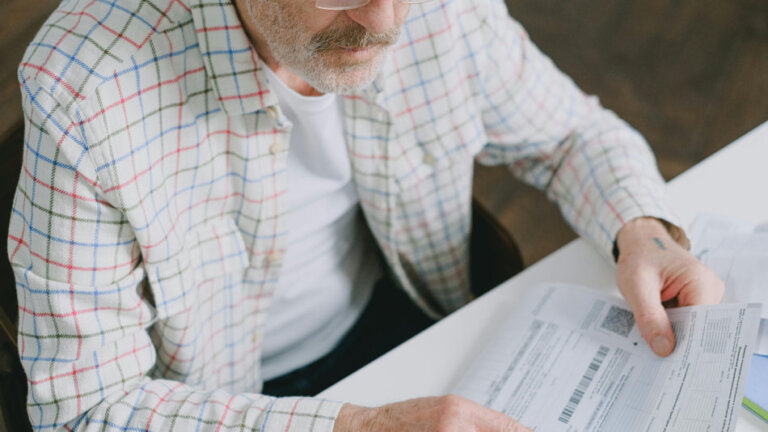Wie verständlich ist dein Text wirklich? Ein Praxistest für mehr Lesbarkeit
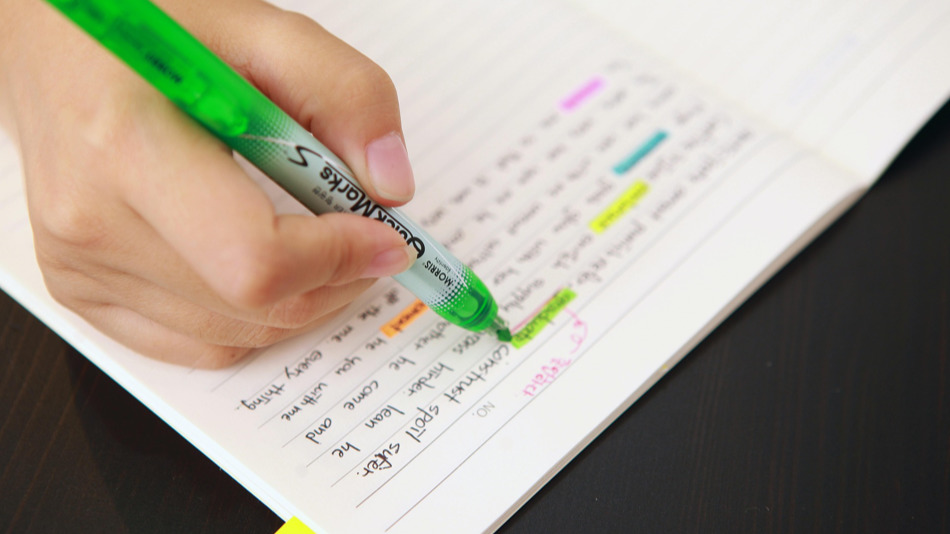
Seiteninhalt
Viele Menschen verbringen Stunden damit, an Formulierungen zu feilen, ohne zu wissen, wie ihr Text auf andere wirkt. Vor allem bei akademischen oder beratenden Texten entsteht schnell eine Sprachwelt, die nur einem kleinen Kreis zugänglich ist. Hier geht es nicht um eine Vereinfachung zu jedem Preis. Gefragt ist eine Sprache, die mitschwingen lässt, was gemeint ist, also eine Sprache, die nicht ausschließt.
Warum Lesbarkeit mehr ist als eine Stilfrage
Ein Text, der gelesen wird, erzeugt eine Wirkung. Ein Text, der verstanden wird, bewegt. Wer nur für sich selbst schreibt, kann auf Rücksichtnahme verzichten. Wer jedoch möchte, dass andere folgen, braucht sprachliche Zugänge. Lesbarkeit heißt in diesem Sinne nicht, jedes Fremdwort zu meiden. Es kommt darauf an, ein Gespür für Rhythmus, Satzlänge und inhaltliche Dichte zu entwickeln. Ein guter Text lässt sich lesen und zugleich mitdenken.
Der Praxistest: So findest du heraus, wie dein Text ankommt
Bevor du dich Programmen oder Skalen zuwendest, hilft ein erster Schritt: laut lesen. Nimm deinen Text, lies ihn dir selbst vor und achte auf drei Dinge:
Bleibst du im Fluss?
Musst du Luft holen an Stellen, an denen gar kein Punkt verschriftet ist?
Kommt der Sinn dort an, wo du ihn vermutest?
Dann folgt Stufe zwei: Gib den Text einer Person, die nicht in deinem Thema steckt. Bitte um ehrliches Feedback.
Wo stockt das Verständnis?
Wo wird der Zusammenhang unklar?
Welche Begriffe bleiben leer?
Notiere dir diese Stellen, ohne sie sofort zu ändern. Du wirst Muster erkennen.
Digitale Werkzeuge als Orientierungshilfe
Programme wie TextLab, Wortliga und der HIX-Index geben Hinweise darauf, wie lesbar dein Text ist. Diese Tools berechnen unter anderem Satzlänge, Silbenanzahl und Fremdwortanteil. Dabei ersetzen sie kein professionelles Urteil, aber sie decken potenzielle Hürden auf. Wer hier mehrfach auffällt, kann zielorientiert überarbeiten.
Sprachliche Feinheiten bewusst einsetzen
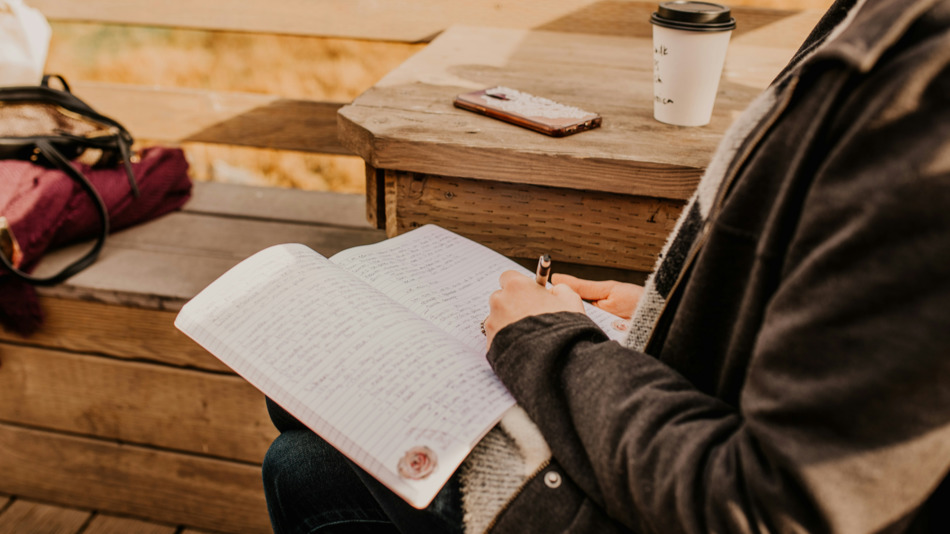
Wie man am besten einen Text schreibt
Ein guter Text spricht MIT statt ZU der lesenden Person. Wichtig sind kurze oder mittellange Sätze, Beispiele und Verben, die Bewegung erzeugen. Abstrakte Begriffe lassen sich oft durch bildhafte Ausdrücke ersetzen. Statt ‚gesellschaftliche Diskurse‘ hilft mitunter die Frage: Wer spricht hier über wen und warum?
Auch Satzanfängen sollte Aufmerksamkeit zuteilwerden. Wiederholungen schleichen sich schnell ein. Ein Wechsel zwischen Fragesätzen, Aussagen und gedanklichen Überleitungen sorgt für willkommene Abwechslung. Wer mit Absicht schreibt, denkt auch die Lesenden mit.
Beispiel 1
Sprachlich wenig gelungene Version (typischer Stilbruch in Fachtexten)
Die Implementation partizipativer Formate stellt eine methodische Herausforderung dar. Die Herausforderung besteht in der Integration diverser Anspruchsgruppen. Die Herausforderung wird durch strukturelle Rahmenbedingungen erhöht. Deshalb erscheint eine systematische Operationalisierung als erforderlich.
Überarbeitete Version
Partizipative Formate sind methodisch anspruchsvoll. Verschiedene Anspruchsgruppen bringen unterschiedliche Perspektiven ein. So entsteht Reibung, aber auch Potenzial. Hinzu kommen Rahmenbedingungen, die nicht immer auf Beteiligung ausgerichtet sind. Hier sind genaue Vorgaben und die Bereitschaft hilfreich, auf Rückmeldungen einzugehen.
Beispiel 2
Sprachlich wenig gelungene Version (zu abstrakt, ohne Bezug)
Infolge der Persistenz organisationaler Routinen ergeben sich Spannungsverhältnisse, die sowohl auf struktureller als auch auf kultureller Ebene zu evaluieren sind. Hierbei ist insbesondere die Ambiguität transformatorischer Prozesse zu berücksichtigen.
Überarbeitete Version
Eingefahrene Routinen lassen sich nicht von heute auf morgen ändern. Wer an Etabliertem rührt, greift auch in gewachsene Arbeitsweisen ein. Im Zuge von Veränderungsprozessen wird deutlich, wie widersprüchlich Erwartungen, Regeln und Erfahrungen sein können.
Fazit? Braucht es nicht, denn der Text wirkt oder nicht.
Stell dir zum Schluss eine Frage: Würde ich diesen Text selbst lesen wollen, wenn ich das Thema nicht kenne? Sofern du mit Ja antwortest, bist du auf einem guten Weg. Im Falle eines Zögerns liest du nochmal laut. Als Einladung, neu zu beginnen.